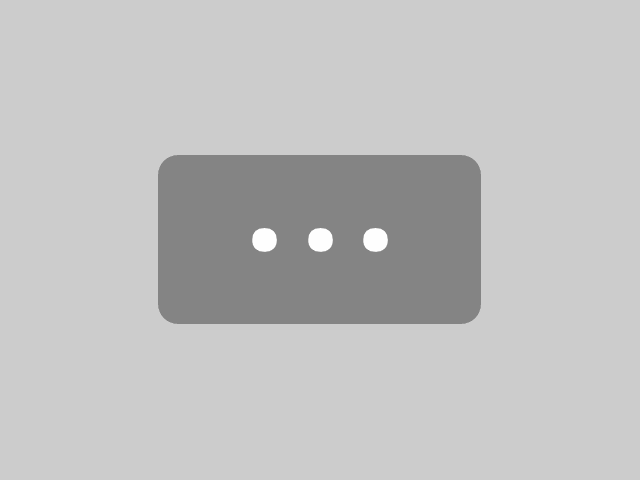Essay von Petra Weiß. Lesedauer ~20 Minuten.
In den letzten Wochen höre ich immer wieder, dass sich die Menschen manipuliert fühlen. Mag sein, dass die Manipulation in unserer Gesellschaft Formen angenommen hat, die schwer zu ertragen sind. Wenn wir die Kultur ändern wollen, fangen wir am Besten bei uns selbst an. „Ich manipuliere doch niemanden!“ werden manche jetzt entrüstet ausrufen. Falls Sie tatsächlich Ihre Bedürfnisse deutlich aussprechen, ohne jemanden emotional unter Druck zu setzen: Prima! Glückwunsch! Die meisten von uns haben das nicht gelernt. Deshalb grämen Sie sich bitte nicht, wenn Sie sich ab und zu dabei erwischen, dass auch Sie die Kunst der Beeinflussung anwenden. Wie sieht Manipulation in unserem ganz normalen Alltag aus? Warum greifen wir zu solchen Methoden? Und welche alternativen Kommunikationsmuster sind denkbar?
„Schatz, der Mülleimer ist voll!“ Wie würden Sie diesen Satz beantworten. „Da hast Du Recht.“ vielleicht? Nein, Sie würden wissen, dass von Ihnen erwartet wird, etwas zu unternehmen. Warum eigentlich? Weil wir diese Form der Manipulation gewohnt sind. Statt zu sagen, was wir wollen, werfen wir etwas anderes in den Raum. Und unser Gegenüber soll gefälligst die passenden Schlüsse ziehen. Probieren Sie einmal, solche Manipulationsversuche großzügig zu übersehen. Statt loszuspurten, um den Abfall zu entsorgen, sagen Sie doch einfach mal „Aha.“ Das kann sehr interessante Reaktionen auslösen. Eine zielführende Erwiderung könnte lauten „Das stimmt. Möchtest Du mir damit noch etwas anderes sagen?“ Gehen Sie nicht stillschweigend darüber hinweg, wenn andere Leute sie manipulieren. Machen Sie den Versuch transparent. Das muss ja nicht im Bösen sein. Sie dürfen dabei ruhig lachen, wenn die Situation es erlaubt.
Bedürfnisse und was keine sind
Oft sind wir uns unserer eigentlichen Bedürfnisse gar nicht bewusst. Nehmen wir mal an, Sie möchten, dass Ihr Mann im Keller die Heizung hochdreht, weil sie frieren. „Mir ist kalt.“ werden Sie vielleicht vorwurfsvoll in den Raum stellen und erwarten, dass Ihr Mann ins Handeln geht. Er wird schon wissen, dass er jetzt in den Keller muss, um die Temperatur zu regeln.
Ist es Ihr Bedürfnis, dass der Mann in den Keller geht? Nein. Sie haben ein Bedürfnis nach WÄRME. Und dieses kann auf verschiedene Arten gestillt werden. EINE davon ist das Heizunghochdrehen durch den werten Gatten. Fallen Ihnen noch weitere Lösungen ein? Es ist wichtig, sich darüber bewusst zu werden, um welches Bedürfnis es geht, damit Sie verstehen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Insbesondere, gilt es herauszufinden, mit welchen Optionen Sie sich Ihren Wunsch selbst erfüllen können. Das entlastet Ihre Beziehungen wesentlich.
Sie könnten zum Beispiel in einen wärmeren Raum gehen. Oder einen dicken Pulli anziehen. Oder sich eine Wärmflasche machen. Oder den Kreislauf in Schwung bringen. Oder sich einen heißen Tee zubereiten. Oder etwas essen. Oder selbst die Heizung hochdrehen. Oder, oder, oder. Merken Sie was?
Die Vielfalt der Möglichkeiten bringt Ihnen Handlungsoptionen. Handlungsoptionen sind das Gegenteil von Ohnmacht. Sie müssen sich nicht ausgeliefert und hilflos fühlen.
Satte Gewinne durch die Opferhaltung
Obwohl ich zugeben muss, dass die gute alte Opferhaltung natürlich auch Vorteile bringt. Man kann sich in Selbstmitleid suhlen. Man erhält Zuwendung und Aufmerksamkeit, wenn man über sein Schicksal klagt. Man kann mit einer Freundin über die Männer schimpfen und durch das gemeinsame Feindbild Verbundenheit erleben. Man kann dem Mann irgendetwas Fieses antun, ohne sich schlecht zu fühlen. Und so weiter. Das gilt für Männer umgekehrt natürlich genauso. Über die Vorzüge des Jammerns und Piensens könnte ich einen eigenen Beitrag schreiben. Darum geht es hier aber nicht primär. Wir schauen darauf, warum wir überhaupt ins Manipulieren kommen.
Ein weiterer Grund kann sein, dass wir nicht Nein sagen können und diese Schmach auch keinem anderen zumuten wollen. Oder – die Kehrseite derselben Medaille – dass wir auf gar keinen Fall Ablehnung erleben wollen. Wenn ich nicht klar frage, muss der andere nicht direkt antworten. Big Deal! Ich lasse die Frage unausgesprochen durch den Äther schweben und kann in die (Nicht-)Reaktion alles hineininterpretieren, was mir beliebt. Erfahrungsgemäß ist das häufig nichts Erquickliches. „Dem ist egal, ob ich mir den A… abfriere.“ ist eine der üblichen Phantasien in so einem Zusammenhang. Kann sein. Kann aber auch ganz anders sein. Erfahren werde ich es nur, wenn ich offen kommuniziere. Am Besten, bevor ungute Phantasien die Stimmung verderben.
„Schatz, mir ist kalt. Könntest Du bitte die Heizung hochdrehen?“ Damit wäre alles erledigt.
Gewaltfrei Klarheit schaffen
Ist die Stimmung schon verrutscht, hilft uns die Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Sie wirkt der Manipulation entgegen, indem Sie die Sachebene und die Gefühlsebene klar trennt und Verwechslungen zwischen Realität und Phantasie beseitigt.
Der Ablauf ist schlicht:
- Tatsache benennen, möglichst sachlich, am Besten eine konkrete Beobachtung.
- Phantasie aussprechen und als solche kennzeichnen.
- Emotion ansprechen, die durch die Phantasie entstanden ist.
- Umsetzbaren Wunsch äußern.
In unserem Beispiel:
- „Hier hat es 19 Grad. Ich friere.“
- „Bei mir ist die Phantasie entstanden, dass es dir gleichgültig ist, wie es mir geht.“
- „Das macht mich traurig.“
- „Ich wünsche mir, dass Du die Heizung hochdrehst.“
Wenn wir noch nicht ganz in unserem Film von „Keine kümmert sich um mich“ versunken sind, fällt uns vielleicht sogar auf, wie absurd die Vorstellung ist, dass der Mann kein Interesse an unserem Wohlergehen hat.
Für den Fall, dass wir einen solchen Mangel an Interesse tatsächlich für Realität halten, wird es Zeit für eine Klärung. Und die spielt sich nicht in unserem Kopf ab, sondern im Austausch.
Meistens handelt es sich bei derlei Phantasien um uralte Glaubenssätze. Deshalb sind solche Situationen wertvoll für die eigene Bewusstseinsentwicklung. Lassen wir das Thema in dieser Stelle ungeklärt, können wir uns weiter einbilden, der andere sei schuld an unserem Leid. Konfrontieren wir ihn aber mit unseren Gedanken, dann kann er dazu Stellung nehmen. Außer, wenn Sie mit einem Psychopathen oder pathologischen Narzissten zusammen sind, wird es Ihren Partner sehr wohl interessieren, wie es Ihnen geht. Er wird vermutlich über Ihre merkwürdige Annahme aufrichtig bestürzt sein. Mit mitfühlender Anteilnahme wird er ihrer traurigen Weltsicht begegnen.
Rollenverwechslung als Wurzel des Übels
Geben Sie ihm Gelegenheit, sich zu Ihren Ideen zu äußern, löst sich Ihre Phantasie aller Wahrscheinlichkeit nach in Luft auf. Für ihre falsche Interpretationen muss es aber einen Grund geben. Nun können Sie sich darüber klarwerden, dass Sie hier möglicherweise noch ein Thema zu bearbeiten haben. Vielleicht sogar ein ganz grundlegendes: Zum Beispiel, dass sie den Partner mit Ihrem Papa verwechseln und er deshalb immer für Sie sorgen soll. Oha! Solche Verwechslungen sind gar nicht so selten und bereiten vielen Paaren Ungemach. Die Mama-Verwechslung umgekehrt natürlich auch. Mit falschen Rollen ist jeder Mensch langfristig überfordert. Das kann nur in Enttäuschung und Vorwürfen enden.
Wenn wir hier Paardynamiken betrachten, dann vor allem deshalb, weil sie die beliebteste Projektionsfläche für unsere ungelösten Seelenthemen und unterschwelligen Konflikte bieten. Ersetzen Sie Partner wahlweise mit Chefin, Nachbar oder Schwester. Häufig betrifft die Rollen-Verwirrung Personen, denen wir nicht ohne weiteres ausweichen können.
Das Feld ist breit, warum wir glauben, jemanden manipulieren zu müssen. Ihn in eine unpassende Position schieben zu wollen, ist ein möglicher Grund, der meist unerkannt bleibt.
Häufig begegnen mir Menschen, die – ohne es zu ahnen – als alleingeborene Zwillinge stets auf der Suche nach einem „Ersatz-Zwilling“ sind. Sie locken oder pressen andere in diese Rolle, der niemand gewachsen sein kann. Und dabei empfinden sie ihre Ansprüche als vollkommen berechtigt. Die Verwechslung ist ihnen ja nicht bewusst. Sie bekommen nicht, was ihnen anscheinend zusteht. Also lassen sie sich allerlei Tricks einfallen, um den anderen doch noch dazu zu bringen, ihre große Sehnsucht zu stillen. Vergeblich.
Mein Bedürfnis – meine Verantwortung
Im ersten Schritt müssen wir uns darüber bewusst werden, dass wir als erwachsener Mensch selbst für das Erfüllen unsere Bedürfnisse verantwortlich sind, dass wir keine Eltern mehr brauchen, um unsere Existenz zu sichern, und dass wir – in den allermeisten Fällen – dazu selbst in der Lage sind.
Das heißt nicht, dass wir isoliert von der Außenwelt leben und nichts von anderen annehmen dürfen oder sollen. Die innere Haltung dabei ist entscheidend: In der Regel geht es nicht darum, Hilfe anzunehmen, sondern Unterstützung. Der Unterschied ist wesentlich. Hilfe heißt: Ich kann es nicht allein und brauche deshalb andere zur Bedürfniserfüllung. Unterstützung hingegen bedeutet: Ich könnte es auch allein, aber durch das Mitwirken anderer wird es schöner, besser, leichter, schneller etc. Hilfsbedürftigkeit erleben wir als Schwäche. Sich passende Unterstützung zu holen, ist ein Ausdruck von Kompetenz. In diesem Sinne können Sie die Suche nach Unterstützung nicht als persönliches Versagen, sondern im Gegenteil als aktive Selbstfürsorge (um-)bewerten.
Selbstwertschätzung – zu viel und zu wenig
Etwas zu wollen, das uns eigentlich nicht zusteht, ist also ein Grund für Manipulation. Die gegenteilige Ursache kann zum selben Ergebnis führen: Man glaubt, das was man braucht, eigentlich nicht verdient zu haben bzw. es nicht wert zu sein. Der Mangel an Selbstwertschätzung ist leider ein weit verbreitetes Phänomen. In diesem Fall wird man ebenfalls nicht direkt um etwas bitten. Man wird darauf entweder verzichten oder versuchen, das Objekt der Begierde mit List und Tücke zu erschleichen und hoffen, dass niemand den Schwindel bemerkt.
List und Tücke sind übrigens nicht für alle Menschen verabscheuungswürdig. Je nach kultureller Prägung, Familientradition oder Typenmuster kann man sogar einen Volkssport daraus machen. Mal sehen, wie weit man gehen kann, bis der andere bemerkt, dass er über den Tisch gezogen wurde. Es gibt Leute, die haben diebische Freude an einem kleinen Betrug, einige brüsten sich sogar damit. Ich habe schon erlebt, dass jemand sich durch clevere Gaunereien beweist, dass er kein Dummer ist. Manchen gibt der Adrenalinstoß einen Kick.
Wenn das Leid des „Opfers“ beim Beurteilen einer Tat gar keine oder eine sehr untergeordnete Rolle, sind wir aber eher wieder bei den psychischen Störungen. Insbesondere der Narzissmus verhindert eine offene Kommunikation über die Bedürfnisse. Das gilt nicht nur für narzisstische Persönlichkeitsstörungen, sondern in abgemilderter Form auch den sogenannten Alltagsnarzissmus.
Fühlt sich ein Narzisst doch als Nabel der Welt und erwartet von seinem Umfeld ein gewisses Maß an Hellsichtigkeit. Er erwartet vorauseilenden Gehorsam, man soll ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen. Wenn er sich dazu äußern muss, kommt das einer Majestätsbeleidigung gleich. Und umgekehrt interessieren ihn die Bedürfnisse der anderen herzlich wenig. Wie kommen sie dazu, diese in seiner erlauchten Gegenwart äußern zu wollen?!
Ich will das Thema Narzissmus hier nicht weiter vertiefen. Diese Anteile nehmen naturgemäß sowieso zu viel Raum ein. Mein Tipp an dieser Stelle: Hören Sie nicht auf die Worte eines Narzissten, sondern schauen Sie auf seine Taten. Wollen Sie dieses Verhalten in Ihrem Leben? Beachten Sie auch die Übereinstimmung Ihrer eigenen Worte mit Ihren Handlungen. Ein bisschen Narzissmus steckt in jedem von uns.
Konflikte auflösen
Die wenigsten Leute lieben es, sich zu streiten. Aber es gibt auch regelrecht konfliktscheue Menschen. Das kann vielfältige Gründe haben. Verlustängste und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit stehen weit oben auf der Liste. Eine ausgeprägte Konfliktscheu macht ebenfalls manipulativ. Konflikte gehören zum menschlichen Miteinander. Wenn sie nicht zutage treten dürfen, ist es wichtig, Klarheit zu vermeiden. Das gelingt durch nebulöse Aussagen, durch Unausgesprochenes und Mehrdeutiges.
Fragen Sie schlicht: „Würdest Du das für mich tun?“ und der Angesprochene hat andere Bedürfnisse, die sich mit Ihrem Wunsch nicht in Einklang bringen lassen, dann ist das ein Konflikt. Wird er gezwungen, „nein“ zu sagen, ist der Konflikt für alle sichtbar auf dem Tisch.
Wie man Konflikte souverän und erwachsen handhaben kann, lernen die wenigsten von Kindesbein an. Wir haben nicht erfahren, dass Konflikte zum Leben ganz selbstverständlich dazugehören und aufgelöst werden. Den äußeren Konflikten können wir ja oft ganz gut ausweichen. Für die inneren Konflikte ist das kein gangbarer Weg. Darum lernen wir das doch lieber im Außen, dann steht es uns auch für das gesunde Wachstum unserer Innenwelt zur Verfügung.
Was hinter der Manipulation liegt…
Die Selbstaufrichtigkeit ist nicht bei allen gleich stark ausgeprägt. Vielleicht werden manche ihre Konfliktscheu, Ihren Narzissmus oder Ihre Verwechslungen vor sich selbst und vor anderen rechtfertigen und kaschieren.
Beliebt sind dabei Erklärungen wie „Ich wollte diplomatisch sein.“, „…dem anderen Gelegenheit geben, sein Gesicht zu wahren.“, „…auf seine Gefühle Rücksicht nehmen.“ und so zu. Es ist verständlich, sich den eigenen Motiven nicht immer stellen zu wollen, um ein gutes Image zu erhalten. Das Selbstbild dient der Stabilität. Aber nur, wenn es aufrichtig ist.
Ihrer Persönlichkeitsentwicklung förderlich ist das Streben nach Authentizität. Seien Sie die Person, die aus Ihnen geworden ist, haben sie Verständnis und Mitgefühl mit ihr. Und dann wenden Sie sich dem Menschen zu, der Sie sein können, der in Ihnen angelegt ist wie eine Blaupause: ihr Selbst.
Das Bewusstwerden von Manipulationsversuchen stoppt nicht nur die Manipulation. Es gibt den Blick frei auf tiefliegende Ursachen, die das eigentliche Problem sind. Und ermöglicht so erst eine ursächliche Lösung. Schon allein für diese Chance lohnt es sich, sich auf den Weg in eine faire und bewusste Kommunikation zu wagen. Das Heilungspotenzial für unsere Beziehungen ist immens: für die Beziehung zu unserem Mitmenschen und zu uns selbst.
Text und Foto: Petra Weiß
Danke schön
Herzlichen Dank an alle Leser, die meine freiberufliche Tätigkeit durch einen Energieausgleich würdigen. Ich liebe die Arbeit an Texten. Mir macht es Freude, mein psychologisches Wissen, meine Praxis-Erfahrungen und meine Überlegungen mit Ihnen zu teilen. Gleichzeitig habe auch ich alltägliche Bedürfnisse wie ein Dach über dem Kopf und etwas Sojasahne im Kühlschrank. Daher bitte ich Sie, freiwillig einen angemessenen Energieausgleich zu leisten:
Konto: IBAN DE48 4306 0967 6022 2369 03
Bank: GLS Gemeinschaftsbank Bochum
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: “Weißheiten”
Ihre Wertschätzung kommt an.
Weitere Beiträge aus der Rubrik: Manipulative Muster erkennen